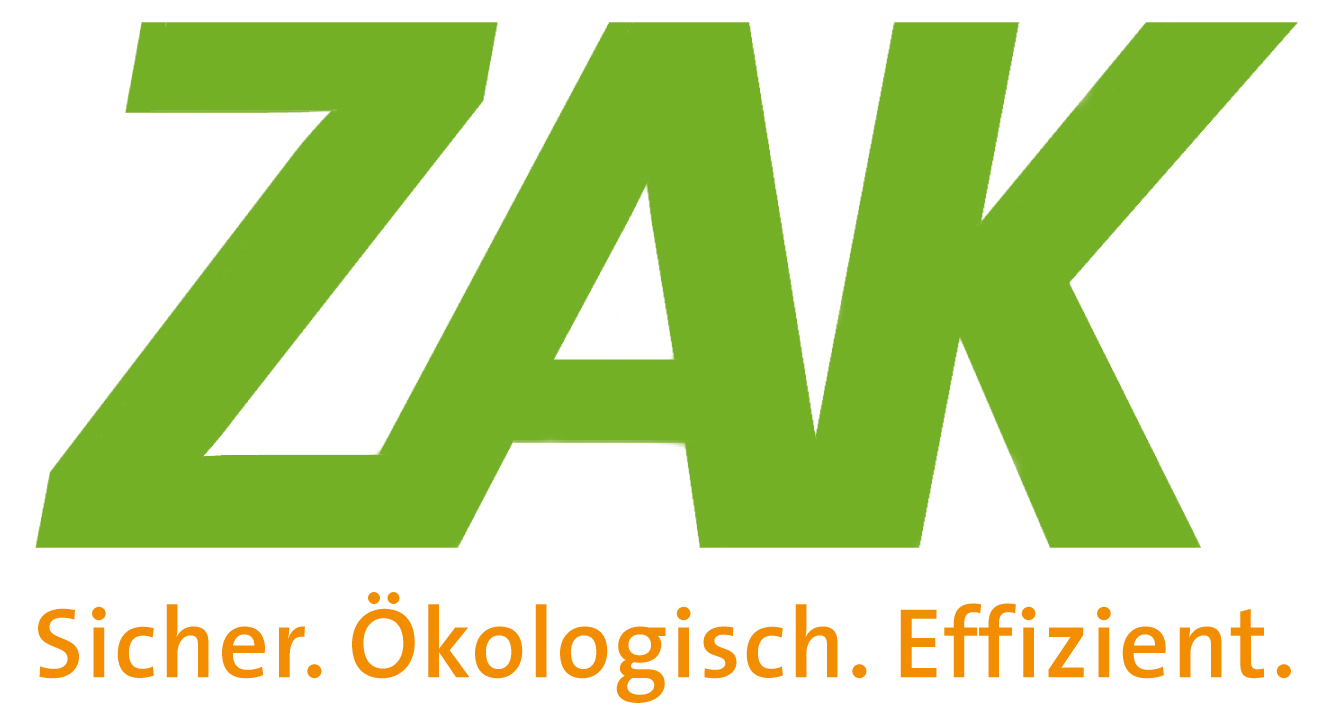Endgültige Absage aus Mainz
Wasserstoff-Projekt wird ad acta gelegt
Kaiserslautern, 31.03.2025
Bis zum Schluss durfte die ZAK – Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern hoffen, dass ihr Wasserstoff-Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (Kipki) des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums vielleicht doch noch zum Zuge kommt. Seit dem letzten Jahr war aber klar, dass die Rahmenbedingungen für eine dezentrale, deutsche Wasserstoffwirtschaft einem Markthochlauf entgegen stehen. Nach der endgültigen Absage aus Mainz wird die ZAK das Projekt jetzt nicht mehr weiter verfolgen. ZAK-Vorstand Jan Deubig, der mit seinem Team das ehrgeizige Projekt vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat, bedauert, dass Wasserstoff in der politischen Diskussion nie wirklich eine Chance bekommen hat: „Die politischen Rahmenbedingungen für eine echte Energiewende mit allen Facetten sind im Moment falsch gesetzt.“
Laut Deubig handelt es sich bei dem Projekt um die „Keimzelle für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in der Pfalz“. Genutzt werden sollte die Infrastruktur des Abfallwirtschaftszentrums, um aus überschüssigen Strommengen aus dem Biomasseheizkraftwerk, Photovoltaik-Anlagen und Windrädern mithilfe der Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Pro Jahr könnten so 140 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden, eine potentielle Erweiterung würde 350 Tonnen ermöglichen. Die Gesamtinvestition für den Bau einer Wasserstoff-Tankstelle und die Umrüstung der Lkw-Flotte beläuft sich auf 17,9 Millionen Euro und hätte bereits 2027 realisiert werden können.
Das Problem: Niemand kann seriös voraussagen, ob Wasserstoff-Schwerlast-Lkws überhaupt bis zum Ende des Förderzeitraums Mitte 2028 verfügbar sind. Das wirtschaftliche Risiko hierfür könne die ZAK nicht allein tragen, so Deubig. Es sei kontraproduktiv, wenn einerseits der Bund die Förderung klimaschonender Fahrzeuge einstelle, andererseits das Land aber davon ausgehe, dass es für den an der beantragten Tankstelle abgegebenen Wasserstoff auch Abnehmer geben werde. Damit sei eine Marktverfügbarkeit solcher brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeuge nur schwer abzuschätzen. Das Land und der Bund müssen diesen Kreislauf durchbrechen, so Deubig.
Das Ministerium hatte für den Bereich der „Wasserstoffstrategie“ eine Fördersumme von insgesamt 25 Millionen Euro ausgelobt. Trotz intensiver Bemühungen und einer ambitionierten Projektskizze schaffte es das Wasserstoff-Projekt der ZAK nicht, in das Investitionsprogramm aufgenommen zu werden. Knackpunkt waren unter anderem die niedrigen Förderquoten, mit der das dezentrale Projekt nicht seriös zu finanzieren sei, so Deubig. Die Fördermittel des Landes werden als Beihilfe angesehen und unterliegen damit den europarechtlichen Restriktionen., wenn sie nicht, was das Land abgelehnt hat, durch die EU notifiziert werden. Dadurch betrage die Förderquote für die Wasserstofftankstelle lediglich 20 Prozent, die für den Elektrolyseur und den Wasserstoffspeicher 45 Prozent. Das ist für einen wirtschaftlichen Betrieb zu wenig. Ungefähr 2,8 Millionen Euro haben gefehlt.
Der ZAK-Vorstand bilanziert: „Wir sind von unserem Projekt nach wie vor absolut überzeugt, obwohl dieses von Beginn an mit wirtschaftlichen und technischen Unwägbarkeiten behaftet war.“ Der Politik habe nach Ansicht Deubigs aber der Mut gefehlt, eine dezentrale Energiewende zu forcieren. Stattdessen setze man auf Importe aus dem Ausland oder der Einfuhr fossiler Brennstoffe.
Ein weiteres Detail birgt zudem finanzielle Wettbewerbsnachteile: Demnach ist Wasserstoff nur dann förderfähig, wenn er als „erneuerbar“ eingestuft wird. Für die EU gilt dabei Strom aus Biomasse zukünftig nicht mehr als erneuerbar. Die ZAK plante, dass der Elektrolyseur Wasserstoff aus Strom erzeugt, der durch die Verbrennung von Abfallbiomasse erzeugt wird. Deubig bedauert, dass die EU die Bedeutung der günstigen Restbiomasse für die Energiewende verkenne. „Der Ausschluss der abfallstämmigen Biomasse von der Förderung verhindert, dass deren energetisches Potenzial im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung voll ausgeschöpft wird.“ Zudem kritisiert er die Diskriminierung der Abfallbiomasse an dieser Stelle als fatal. Weil der Einsatz von Biomasse die CO2-Ausstoss nur vermeide und nicht reduziere, würde man sehenden Auges hier eher einen CO2-Ausstoss aus fossilen Energieträgern in Kauf nehmen, obwohl die Abfallbiomasse unvermeidbar zur Verfügung stehe. Deubigs Appell an das Wirtschaftsministerium: „Wenn das Land Rheinland-Pfalz den Markthochlauf für Wasserstoff in der Region ernsthaft voranbringen will, muss es zumutbare Rahmenbedingungen für die kommunalen Akteure schaffen.“ Bund und Länder müssten nach Wegen suchen, kommunale Projekte wie das der ZAK „außerhalb des Anwendungsbereichs der AGVO zu fördern“. So sei es denkbar, dass Deutschland staatliche Beihilfen bei der EU im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens anmelde und genehmigen lasse. Deubig ist sicher: „Ohne staatliche Subventionen kann die junge Wasserstoffwirtschaft nicht vorangebracht werden.“